V. Apprendi (2004) Bestenlisten: Weg aus der Mittelmäßigkeit. die-Besten-nennen 23:
www.die-besten-nennen.de
© Vless Ebersberg, 2004
Bestenlisten: Weg aus der Mittelmäßigkeit
Inhaltsverzeichnis
Überblick
Ausgangslage:
Gute Chancen für das Mittelmaß
Nachteile der Mittelmäßigen:
1.
Von ihnen können
Studenten und Assistenten kaum Erstklassigkeit lernen
2.
Sie können
nur mittelmäßig komplizierte Probleme lösen
3.
Ihre Leistungen
sind teuer
4.
Sie bleiben
auch in der Zukunft mittelmäßig
5.
Ihr Image
ist nicht durch hochwertige Forschungsleistungen begründet
Wer
mittelmäßige Wissenschaftler stärkt, fördert mittelmäßige Wissenschaften
Wie man die Besten erkennt
Wo man die Besten findet
Was die Erstellung der Bestenlisten so aufwendig macht
Was
die Besten gemeinsam zur internationalen Forschung beitragen
Wie sich die Namen der Besten verbreiten
Literatur und Links
Auch Sie können weiter helfen
Überblick: In Anlehnung an die methodische
Kompetenz der Testpsychologie sind in den letzten Jahren wissenschaftliche
Messmethoden für qualitativ hochstehende und international erfolgreiche
Forschungsleistungen entwickelt worden, mit denen objektiv und valide die
international bedeutsamsten Wissenschaftler, also die Besten erkannt werden
können. Solange derartige Methoden fehlten, hatten mittelmäßige Forscher
hervorragende Chancen sich durchzusetzen und die Mittelmäßigkeit auszuweiten.
An ihnen können aber hochbegabte Studenten und wissenschaftliche Assistenten
kaum Erstklassigkeit lernen. Mittelmäßige vermögen auch kaum hoch komplizierte
Probleme lösen. Ihre Forschungsleistungen sind im Vergleich zum internationalen
Wert ungebührlich teuer. Demgegenüber fühlen sich die Produzenten hochwertiger
Forschungsleistungen unter dem Einfluss der Mittelmäßigen oft unfair behandelt
und werden in ihrer Produktivität entmutigt oder gar behindert.
Die Bestenlisten
sollen dazu beitragen, wissenschaftliche Höchstleistungen durchzusetzen, indem
sie die identifizieren und öffentlich nennen, die sie erbringen können und dies
dazu meist immer wieder, über Jahrzehnte hinweg. Die Betroffenen und die durch
ihre Steuern für Forschungsleistungen zahlenden Bürger und die Massenmedien
können ebenfalls dazu beitragen, dass sich rasch effiziente, international
erfolgreiche Forschung und Forscher durchsetzen.
Ausgangslage: Gute Chancen für das Mittelmaß
Die Aufnahme in die Bestenlisten hat mich darin
bestärkt, dass meine Forschungsbemühungen erfolgreich und sinnvoll waren.
Der Aufbau der Bestenlisten war dringend notwendig, um der
effizienten Forschung eine bessere Chance als bisher zu geben.
Derartige Aussagen stammen von Wissenschaftlern,
die schließlich in die Bestenlisten aufgenommen wurden, nachdem sie das
Verfahren der Auswahl durchlaufen hatten, in dem sie unter den weniger
leistungsfähigen Kollegen identifiziert und in dem die Rechercheergebnisse zur
Absicherung mehrfach überprüft worden waren.
Aus den Äußerungen der Besten geht folgendes
hervor:
Forscher sind sich über ihren
internationalen Erfolg oft nicht sicher.
Forscher brauchen selbst
Anerkennungen für hervorragende Leistungen.
Effiziente Forschung benötigt
die Erkennung und Hervorhebung der besten Köpfe.
Wissenschaftler hatten bisher nur mehr oder
wendiger zufällige, nicht selten sehr subjektive Rückmeldungen über den
internationalen Erfolg ihrer Forschungsarbeiten. Derartige Rückmeldungen ließen
einige Fragen offen, insbesondere, was subjektive Einzelurteile überhaupt wert
sind und außerdem, wie hoch der Erfolg war.
Das Problem, die Ausprägung von Erfolg zu messen,
musste gelöst werden, bevor sich Bestenlisten aufbauen ließen. Die Lösung hatte
die Testpsychologie, speziell Intelligenz- und Persönlichkeitspsychologie in
einer rund hundertjährigen Tradition bis zu einem hohen Reifegrad entwickelt:
Sie bildet Normen über eine Bezugsgruppe und vergleicht damit bei ihren
späteren Einzelfalldiagnosen den Einzelnen: Wo ist anhand der Normen seine
Position im Vergleich zu den anderen zu finden? Im unteren mittleren oder
oberen Bereich?
Über den internationalen Forschungserfolg wurden
derartige Normen in mehrjährigen Vorarbeiten an mehr als 40 medizinischen
Fachrichtungen entwickelt. Damit sind individuelle Forscher nun vergleichbar.
Deshalb lässt sich objektiv angeben, wer zu den Besten, Guten, Mittleren oder
Unterdurchschnittlichen gehört.
So nebenbei haben diese Entwicklungen auch
weitere wichtige Erkenntnisse über die Forscher zu Tage gefördert (siehe ersten
Rahmen und weiteren Text unten). Besonders wichtige Entdeckungen sind:
1.
Die Ausprägung des
internationalen Forschungserfolgs bleibt über viele Jahre weitgehend stabil.
2.
Die Ausprägung des
internationalen Forschungserfolgs geht mit dem Niveau an Leistungsqualität
einher.
3.
Nach etwa siebenjähriger
wissenschaftlicher Tätigkeit hat sich die Spreu vom Weizen getrennt: Wer bis
dahin im Vergleich zu Fachkollegen wenig internationalen Erfolg hatte, wird
auch später kaum Leistungen erbringen, welche einen großen Einfluss auf das
internationale Forschungsgeschehen haben. Andererseits stehen hinter
international einflussreicher Forschung meist die selben Köpfe, dies schon nach
wenigen Wissenschaftlerjahren und dazu über Jahrzehnte.
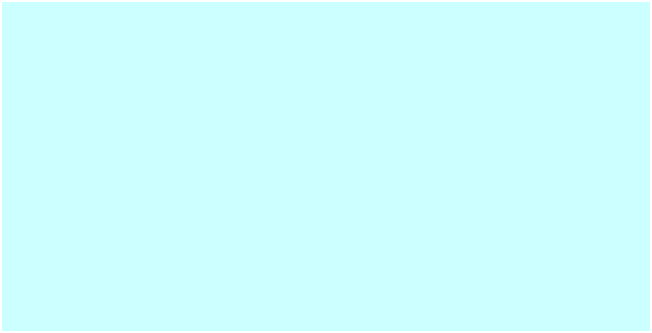
Deshalb nennen die Bestenlisten nicht nur die
qualitativ sehr hochstehenden Forscher, sondern umfassen auch einen stabilen
Kern an Forschpersönlichkeiten, an dem sich über viele Jahre nichts ändert.
Die Bestenlisten konnten erst nach den
angeführten aufwendigen Vorarbeiten entstehen. Sie sollen dazu beitragen, die
Unsicherheit über die international wertvollen Forschungsleistungen zu beheben
und das Image hervorragender Forschungsleistungen mit tatsächlich exzellenten
Forschungsleistungen in Übereinstimmung bringen.
Bisher nutzten viele, die nachweislich zu keinen
Spitzenleistungen in der Lage waren, den unsicheren Zustand, die Qualität und
den internationalen Nutzen von Forschung objektiv und valide festzustellen. Sie
ließen sich und ihre Projekte ungebührlich fördern und manchmal auch feiern.
Dies schadet vielen, den Leistungsträgern, dem
Forschungsnachwuchs, der auf Vorbilder angewiesen ist, dem Steuerzahler, der
für Forschung zahlt und schließlich der gesamten Gesellschaft, die von den
Wissenschaften einen erheblichen Beitrag zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen
Zukunft erwartet. Darauf wird nachfolgend näher eingegangen.
Nachteile
der Mittelmäßigen
1
Mittelmäßige Forscher: von ihnen können Studenten und Assistenten kaum
Erstklassigkeit lernen
Warum sollen sich hochbegabte international
ambitionierte Studenten oder wissenschaftliche Assistenten mit
Forschungsvorbildern begnügen, die nicht zu den ausgewiesenen Besten gehören?
Was können sie von jemand lernen, der die eigene Forschung nicht auf ein
international erfolgreiches Niveau bringt, der also genau genommen nichts
oder wenig unmittelbar zum internationalen Fortschritt beiträgt? Wohl kaum, wie
man sich rasch auf internationalen Forschungserfolg vorbereitet.
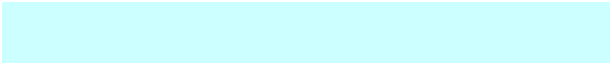
2. Mittelmäßige Forscher: sie können nur mittelmäßig
komplizierte Probleme lösen
Das hohe Qualitätsniveau ihrer wissenschaftlichen
Arbeiten zeichnet die besten Forscher aus. Um Probleme zu lösen, die andere
bisher nicht bewältigten, müssen sie über unvergleichlich profunde
Vorkenntnisse und eine hohe Originalität sowie Sorgfalt verfügen. Außerdem
müssen sie in der Lage sein, ihre Lösungsversuche weitgehend widerspruchsfrei
und verständlich darzustellen. Denn wirre Gedanken erkennt die internationale
Gemeinschaft der Wissenschaftler (Scientific Community) nicht an. Und bei
schriftlichen Darstellungen ist Verworrenes viel leichter als bei den
flüchtigen Worten in Vorträgen oder Gesprächen zu erkennen.
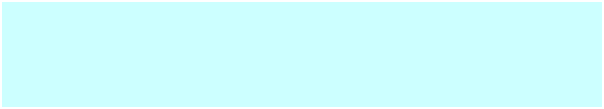
Diese ständige Auseinandersetzung mit
komplizierten Sachverhalten hält die Besten selbst auf Trab und macht sie nicht
selten noch besser ... bis in´s hohe Alter.
3
Mittelmäßige Forscher: ihre Leistungen sind teuer
Viele Wissenschaftler kann man erheblich
persönlich fördern, durch die Verbesserung der personellen und materiellen
Rahmenbedingungen und durch die Finanzierung vieler Forschungsprojekte. Die
Frage ist: Bei wem rentieren sich derartige Investitionen?
Eher nicht bei den Wissenschaftlern, die bereits
seit einigen Jahren Forschungsmöglichkeiten hatten und keine internationalen
Erfolge aufweisen; denn diese werden auch weiterhin keine internationalen
Erfolge haben. Sie kosten viel Geld und bringen wenig.
Sie entziehen nicht nur den anderen, die es
besser könnten, die Förderung, sondern bekämpfen sie manchmal noch, weil sie
durch die Konkurrenten ihre Reputation und Förderung gefährdet sehen.
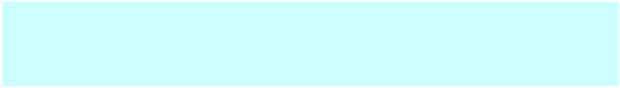
![Textfeld: Der internationale Wert der Forschung:
Konkret schreibt Nadja Pastega im Wirtschaftsteil von facts (26/2003, 24.6.04; www.facts.ch/dyn/magazin/wirtschaft/389038.html) unter der Überschrift Ausgebremste Turbodenker: Jeder dieser [in www.die-besten-nennen.de gelisteten] Top-Wissenschaftler generiere in seinem Leben Forschungsarbeiten im Wert von geschätzten 72 Millionen Franken. Ihre Gehälter unterscheiden sich dabei kaum von denen mittelmässiger Fachkollegen*, die jährlich nur einen Forschungswert von 60'000 bis 120'000 Euro erzielen.
*mit Habilitation und/oder Professur [Ergänzung durch den Autor]](text23-Dateien/image005.gif)
4. Mittelmäßige Forscher: sie bleiben auch in der Zukunft
mittelmäßig
Wird die Forschungsexzellenz durch ein, zwei
hervorragende Leistungen kurz sichtbar und verschwindet sie dann wie
Eintagsfliegen aus dem Lichtkegel der internationalen Wissenschaften? Nein.
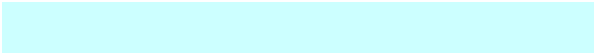
Eine naheliegende Erklärung ist, dass auf dem
Boden überdauernder Persönlichkeitseigenschaften - wie Freude an geistiger
Tätigkeit, extrem hohes Niveau an flüssiger Intelligenz und Durchhaltefähigkeit
- über Jahre eine hohe Fachkompetenz aufgebaut wurde, die kaum verloren geht.
Außerdem werden, wie schon erwähnt, die Leistungen exzellenter Wissenschaftler
von Kollegen, Patienten, Öffentlichkeit usw. gesucht und dadurch ständig neue
Anforderungen gestellt, die sie wissenschaftlich auf Trab halten und ihren
Abfall auf die Mittelmäßigkeit verhindern.
Ebenso wie hervorragende sind auch mittelmäßige
Wissenschaftler berechenbar: Diese waren, sind und bleiben in der Regel
mittelmäßig und zeigen keine Ausflüge in´s Hochklassige.
5. Mittelmäßige Forscher: ihr Image ist nicht durch
hochwertige Forschungsleistungen begründet
Leistungsgerechte Imagebildung bei Forschern
besteht in der Anpassung von deren Image an den tatsächlichen Wert ihrer
Forschung für die internationalen Wissenschaften.
Nicht wenige Wissenschaftler haben eine
hervorragende Reputation als Forscher, obwohl sie nach den wissenschaftlichen
Messmethoden im Vergleich zu ihren Fachkollegen nur mittelmäßig sind und auch
in der Vergangenheit nie zur Spitze gehörten. Welche Gründe gibt es für
derartige, nicht leistungsgerechte außergewöhnliche Images?
Zugehörigkeit zu einer
renommierten Forschungseinrichtung (z.B. Max-Planck-Institut; Universität)
Fortführung der Stelle eines
Vorgängers, der selbst ein hohes internationales Ansehen als Forscher genoss
Sich mit den Leistungen
anderer schmücken, beispielsweise durch Besetzung vorderer Autorenpositionen in
Publikationen, obwohl dazu keine wissenschaftlich wertvollen Beiträge erbracht
wurden
Führen vieler akademischer
Grade
Auszeichnung durch
wissenschaftliche Preise
Öffentliche Verbreitung, dass
man eine internationale Ausbildung genossen habe
Öffentliche Verbreitung, dass
man viele internationale Kontakte unterhalte
Alle diese imagebildenden Maßnahmen lassen sich
durch mittelmäßige wissenschaftliche Leistungen erreichen, wenn man vielleicht
von einigen seltenen Ehrungen wie dem Nobelpreis absieht. Es gibt aber allein
im deutschsprachigen Bereich Tausende von wissenschaftlichen Preisen und
Anerkennungen, deren Wert kaum jemand einschätzen kann, der jedenfalls nicht
außerordentlich sein kann.
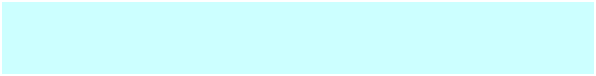
Wer
mittelmäßige Wissenschaftler stärkt, fördert mittelmäßige Wissenschaften
Wissenschaften werden von Menschen gemacht und
können daher nicht besser sein, als es deren geistiges Leistungsvermögen, also
das Intelligenzniveau der besten Köpfe hergibt.
Wenn die weniger guten Köpfe die Wissenschaften
bestimmen, muss sie allerdings schlechter sein, als sie sein könnte.
Zwischen den wissenschaftlich tätigen Köpfen
herrschen Leistungsunterschiede, wie sie von Laien kaum für möglich gehalten
werden. Dies trifft nicht nur für geistige Leistungen allgemein, sondern auch
die wissenschaftlichen im Besonderen zu. Ohne besondere Methoden aus der
Szientometrie, die sich mit Messungen der Wissenschaften, aber auch
Wissenschaftler beschäftigt, sind die Differenzen jedoch selbst für szientometrisch
ungeschulte Wissenschaftler kaum zu erkennen.
Diese Unterschiede zu vernachlässigen, rächt sich
in Gesellschaften, deren wirtschaftliche Entwicklung mangels Rohstoffen auf
hochklassige Wissenschaften angewiesen ist, um im globalen Wettbewerb bestehen
zu können. Denn wer die mittelmäßigen Wissenschaftler stärkt, fördert
mittelmäßige Wissenschaften. Diese können im internationalen Wettbewerb nicht
mithalten und taugen daher wenig als Zugpferde ihrer Wirtschaft.
Die Besten zu erkennen und zu
nennen ist ein Programm, die geistig leistungsfähigsten Köpfe mit Hilfe
objektiver und valider Methoden zu identifizieren und für Interessenten
herauszustellen, um dadurch leistungsfähige Wissenschaften und internationale
Wettbewerbsfähigkeit zu stützen.
Wie man die Besten erkennt
Objektive und valide Methoden zu entwickeln, mit
denen sich die Besten erkennen lassen, erforderte erhebliche Bemühungen der
szientometrischen Forschung.
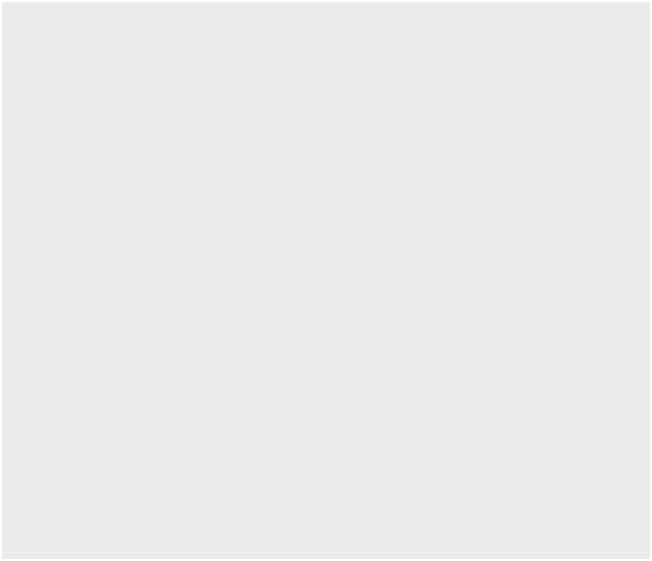
Anmerkung zur
zweiten Methode, weil sie unter Wissenschaftlern eine große Beachtung gefunden
hat. Damit ermittelt die Zeitschrift Labourjournal Rankinglisten. Sie
verfolgt allerdings eine andere Absicht als die Bestenlisten. Denn sie will die
meistzitierten Arbeiten und Köpfe und gleichzeitig erfolgreiche
Forschungseinrichtungen der letzten Zeit erkennen. Darin schließt sie
wissenschaftlich mitveröffentlichende Mitarbeiter - manchmal nur Mitläufer -
ein, von denen weniger Impulse für die betreffenden Forschungsleistungen
ausgingen. Die Bestenlisten identifizieren hingegen die international
erfolgreiche Forscherpersönlichkeit.
Nun sind die Methoden und die im Laufe von deren
Einsatz gewonnenen Erkenntnisse vorhanden und es geht darum, sie praktisch
einzusetzen, um die Namen der Besten zu identifizieren und öffentlich bekannt
zu machen. Aber wo findet man die Besten?
Wo man die Besten findet
Viele erwarten, die Besten der Wissenschaftler an
den Forschungsstellen, in Universitäten und großen Forschungseinrichtungen
ihres Landes zu finden - soweit die Spitzenforscher nicht schon in der Hoffnung
auf bessere Arbeitsbedingungen in das Ausland abgewandert sind.
Doch nicht wenige, besonders
in der Medizin, sind auch in der forscherischen Provinz anzutreffen, in nicht
primär forschenden Krankenhäusern oder in ärztlichen Praxen. - Sie erkennen es
aus den Adressen der GaM-Bestenlisten.
Wieder andere befinden sich bereits im Ruhestand
und forschen entlastet von den dienstlichen Routinetätigkeiten weiter. Dies
kennzeichnet Vollblutforscher, die den Kern der in die Bestenlisten
Aufgenommenen bilden: nicht jeder Vollblutforscher erbringt die
Leistungsqualität, die für die internationale Durchsetzung notwendig ist. Wer
dieses Qualitätsniveau erreicht, ist jedoch fast immer Vollblutforscher. Und ein
solcher ist bei jeder Gelegenheit wissenschaftlich aktiv, auch im Ruhestand.
Exzellente Forscher im Ruhestand gehören also in die Bestenlisten, weil sie
noch ständig hochkarätige wissenschaftliche Leistungen nachliefern.
Potenziell kommt jeder für die Bestenlisten in
Betracht, der international erfolgreiche wissenschaftliche Publikationen
verfasst. In der Medizin des deutschsprachigen Raumes sind diese Personen unter
den rund 100.000 Wissenschaftlern zu suchen, die sich durch Veröffentlichungen
ausgewiesen haben oder die Dienststellen innehaben, auf denen sie
veröffentlichen sollten. Etwa 20.000 davon sind habilitiert und/oder
professoriert.
Was die Erstellung der Bestenlisten so
aufwendig macht
Im Computerzeitalter sollte es kein großes
Problem sein, die Größenordnung von 100.000 Wissenschaftlern systematisch
danach abzusuchen, wie viel ihre Arbeiten zum internationalen
Forschungsgeschehen beitragen. So denken offenbar viele, auch Wissenschaftler.
Doch tun sich tatsächlich mehrere erhebliche
Schwierigkeiten auf. Dazu gehören die folgenden:
1.
Die deutschsprachigen
Wissenschaftler sind nicht genau definiert, weder wer der Sprache nach dazu
gehört noch, wer alles als Wissenschaftler zählt.
2.
Eine computergestützte
Erkennung aller Autoren wissenschaftlicher Publikationen würde mindestens zwei
Drittel aller Veröffentlichungen außer Acht lassen, weil sie per Computer,
genauer per Internet, nicht direkt zugänglich sind.
3.
Das Kollektiv der
Wissenschaftler ist dynamisch, das heißt, es ändert sich ständig: junge
Erwachsene werden Wissenschaftler, gestandene Wissenschaftler wechseln den
Beruf; Krankheiten oder Tod verhindern weitere wissenschaftliche Aktivitäten;
einige Forscher verlassen den deutschsprachigen Bereich, andere kommen aus dem
nichtdeutschsprachigen Gebiet hinzu usw.
Am verlässlichsten sind die Erfassungen der
habilitierten und/oder professorierten Wissenschaftler. Sie bilden den harten
Kern, sind aber schon nach wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit ausgelesen. In
dieser Hinsicht haben sie im Mittel, jedoch nicht in allen Einzelfällen ein
deutlich höheres Niveau als die Wissenschaftler mit geringeren akademischen
Graden. An den Leistungen der Habilitierten bzw. Professoren orientieren sich
die Auswahlen für die Bestenlisten, die allerdings prinzipiell für alle
Wissenschaftler offen sind.
Wie findet man nun aus einem großen Potenzial an,
wie auch immer definierten Wissenschaftlern die Besten heraus?
Hierbei treten neue Schwierigkeiten auf, die vor
wenigen Jahren noch gar nicht lösbar waren.
1.
Es müssen wissenschaftlich
begründbare Erkenntnisse vorliegen, wer als schlechter, mittelmäßiger,
guter oder gar hervorragender Forscher zu bewerten ist.
2.
Die Bildung derartiger
Erkenntnisse setzt wiederum die Verfügbarkeit entsprechender szientometrischer
Methoden voraus.
Die notwendige Kompetenz hat sich nach
Jahrzehnte-langen wissenschaftlichen Entwicklungen herausgebildet.
Zwischen den allgemeinen Erkenntnissen und der
Anwendung auf den Einzelfall liegen weitere Schwierigkeiten, wie sie aus der
Diagnostik in der Medizin oder der Testpsychologie bestens bekannt sind.
Insbesondere an den Methoden der letzteren muss sich die Auslese der besten
Forscherpersönlichkeiten orientieren. Das bedeutet, dass
1.
von den in Betracht kommenden
Wissenschaftlern zuerst objektive, reliable und valide Messwerte zu erheben
sind;
2.
die Messwerte, die über
Einzelne erhoben wurden, auf Normen einer Bezugsgruppe zu beziehen sind;
3.
Normen einer geeigneten
Bezugsgruppe zur Verfügung stehen. Die Bezugsgruppe sind hier die forschenden
bzw. dienstlich zur Forschung verpflichteten Fachkollegen.
Einen Einblick in die Schwierigkeiten in
Verbindung mit diesen drei
Punkten gibt der folgende Rahmen.
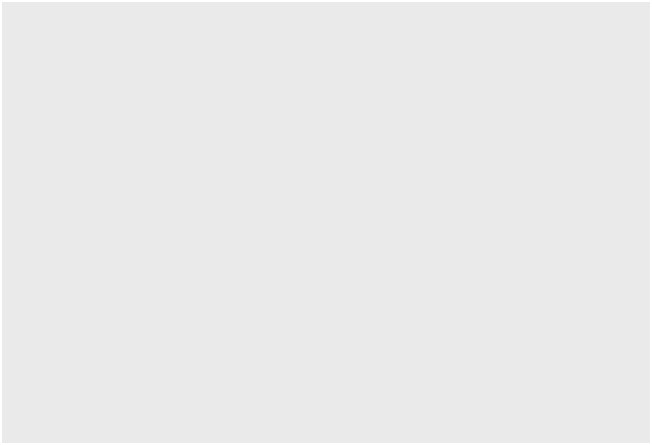
Trotz all der aufgezeigten Schwierigkeiten dürfen
möglichst keine Fehler unterlaufen, weil es um Einzelpersonen und deren
Schicksale geht. Fehlzuordnungen können für die Karriere der Betroffenen schwer
einschneidende Folgen haben. Deshalb erfordert die Aufnahme in die Bestenlisten
entsprechende Rückversicherungen bei den ermittelten Wissenschaftlern.
Von der Gewinnung allgemeiner wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden bis hin zur Identifizierung individueller Personen
und abschließenden Absicherung der Rechercheergebnisse ist es also ein
aufwendiger Weg. Die Besten herauszufinden,
ist mit mehr Know-how und Aufwand verbunden, als es sich viele, dies gilt auch
für Wissenschaftler, vorstellen.
Warum haben die meisten Wissenschaftler nicht die
szientometrische Kompetenz, die doch einen so engen Bezug zu ihren
vorherrschenden Aktivitäten und deren Bewertung hat? Möglicherweise ist dies
der Grund: Die meisten Forscher widmen sich intensiv ihrem speziellen
Fachgebiet, welches beispielsweise auf bestimmte biochemische Vorgänge, auf die
Operierbarkeit des Herzens, auf die Beziehungen zwischen Patient und Arzt usw.
ausgerichtet ist. Sich in ihrem Fachgebiet ihren Fähigkeiten entsprechend zu
bewähren, erfordert den vollen Einsatz. Dadurch haben sie keine geistigen
Kapazitäten mehr frei, sich professionell mit der Qualität von Forschungsleistungen
und deren Messung zu befassen. Deshalb bildet die Metaforschung, die sich mit
dem komplexen Gebiet der Forschung über Forschung beschäftigt, eine eigene
Fachdisziplin.
Was die
Besten gemeinsam zur internationalen Forschung beitragen
Das Ziel ist, die Bestenlisten der
Fachdisziplinen zu einem Stand aufzubauen, in dem ein Fließgleichgewicht
herrscht: einige Wissenschaftler meist der Forschungsnachwuchs - kommen neu
hinzu, weil sie nun die Aufnahmekriterien erfüllen; andere fallen heraus. Die
Mehrheit wird jedoch über viele Jahre bleiben.
Einige Fächer, wie die Psychiatrie oder
Orthopädie haben bereits den Zustand erreicht, in dem das Fließgleichgewicht
herrscht, in dem sich also nicht viel ändert.
Wer das Aufnahmekriterium in einem Fach erreicht,
trägt zum internationalen Forschungsgeschehen mindestens das je nach Fach
etwa Zehnfache bei wie der durchschnittliche habilitierte und/oder
professorierte Fachkollege. Die Mehrheit der Besten überschreitet das
Aufnahmekriterium aber deutlich. Im Mittel haben sie die 20-fache Wirkung auf
die internationale Forschung gegenüber ihren durchschnittlichen habilitierten
und/oder professorierten Fachkollegen. Würde man in den Vergleich die
Fachkollegen mit niedrigeren akademischen Graden einbeziehen, wäre der
Unterschied noch viel größer.
Der gemeinsame Beitrag der Besten zur
internationalen Forschung ist mindestens genau so groß, wie der Beitrag der 90
Prozent der habilitierten und/oder professorierten Fachkollegen zusammen, die
nicht die Aufnahmekriterien erfüllen.
Würde man die internationale Wirkung der
wissenschaftlichen Fachkollegen mit niedrigeren akademischen Graden
einbeziehen, ergibt sich immer noch nahezu das Verhältnis, wonach die Besten in
ihrer Gesamtheit international die gleiche Wirkung wie alle anderen
Wissenschaftler ihres Faches haben. Nur: die Besten machen ihrer Anzahl nach
maximal zwei Prozent und die restlichen gut 98 Prozent an allen
Wissenschaftlern aus.
Unter diesen Gesichtspunkten sollten Sie einmal
die Listen der nicht mehr im Aufbau befindlichen Gruppen wie der Psychiater,
der Urologen oder der Orthopäden bewerten.
Wie sich die Namen der Besten verbreiten
Viele der Namen in den
Bestenlisten sind in ihrem fachlichen Umfeld und darüber hinaus bereits als
hervorragende Forscher bekannt. Aber es ist nicht bestätigt, dass sie wirklich,
das heißt objektiv und valide zu den Besten gehören. Denn so mancher, für den
internationalen Forschungsfortschritt weitgehend unbedeutende Forscher, besitzt
ebenfalls das Image, wissenschaftlich exzellent zu sein.
Damit sich die international
Leistungsstarken und mit ihnen effiziente Forschung durchsetzen, sollten sie
möglichst allen bekannt sein, die daran interessiert sind. Die Schwierigkeit
besteht darin, das Wissen all diesen Interessierten zugänglich zu machen,
wonach es frei zugängliche Listen im Internet gibt, anhand derer man sich nach
Belieben über die Namen, die Fachzugehörigkeit und den Wirkungsort der Besten
informieren kann.
Die Verbreitung dieses Wissens
läuft parallel zum Aufbau der Bestenlisten. Sie beginnt bei der entsprechenden
Informierung der Betroffenen und weitet sich von da über die Fachkreise bis zur
Öffentlichkeit aus. Während die Informationen die Betroffenen und deren
Fachkollegen mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen, spielt der Zufall stärker
dabei mit, wer aus der breiten Öffentlichkeit davon erfährt.
Wie läuft die Verbreitung der
Bestenlisten bzw. der darin aufgenommenen Namen zur Zeit tatsächlich ab?
Zuerst ist es einmal wichtig,
dass die durch die Messungen identifizierten und durch Zusatzrecherchen
gesicherten Besten selbst wissen, dass sie dazu gehören, damit sie auch dazu
stehen können. Denn über die eigene Position als international erfolgreicher
Forscher im Vergleich zu Fachkollegen herrscht Unsicherheit, solange keine
Untersuchungen anhand von Normen stattfanden.
Die in die Listen
Aufgenommenen erfahren selbstverständlich davon, dass sie zu den Besten
gehören und dass sie deshalb in die Bestenlisten aufgenommen wurden. Wenn sie
es dort nachlesen, finden sie auch die Namen von Kollegen, deren internationale
Leistungsstärke ebenfalls nachgewiesen ist.
Weitere punktuell gestreute
Maßnahmen sorgen dafür, dass dieses Wissen nicht nur im Kreis dieser Ersten
Liga der Forscher des deutschsprachigen Gebietes bleibt, sondern auch zu
anderen interessierten Gruppen findet.
So berichteten bereits einige
Dutzend Zeitungen über die ausgewählten Medizinforscher ihrer Region. Viele
werden noch folgen.
Einige Zeitungen stellten ihre
Mitteilungen der Druckausgaben auch in das Internet. Dazu gehört die beiden
Beispiele aus Nürnberg und aus Bremen, von denen Sie Ausschnitte in den
folgenden Rahmen finden.
![Textfeld: Nürnberger Presse, auch im Internet:
http://www.klinikum-nuernberg.de/zeitung/3_2003/personalien.html
In die Liste der führenden Köpfe der deutschsprachigen Medizin ist ... aufgenommen worden. Die von der Gesellschaft für angewandte Metaforschung erstellte "Bestenliste der Medizin" verwendet bei der Beurteilung der Mediziner ein an der Universität Erlangen aus amerikanischen und ungarischen Ansätzen entwickeltes objektives Maß, das die Anzahl der wissenschaftlichen Arbeiten in qualitativ gehobenen internationalen Zeitschriften vergleicht. [Die] Veröffentlichungen [von ...] tragen demnach "erheblich zum gegenwärtigen Fortschritt der weltweiten Medizin bei.
Die "Bestenliste der Medizin" ist im Internet unter www.die-besten-nennen.de zu finden.](text23-Dateien/image010.gif)
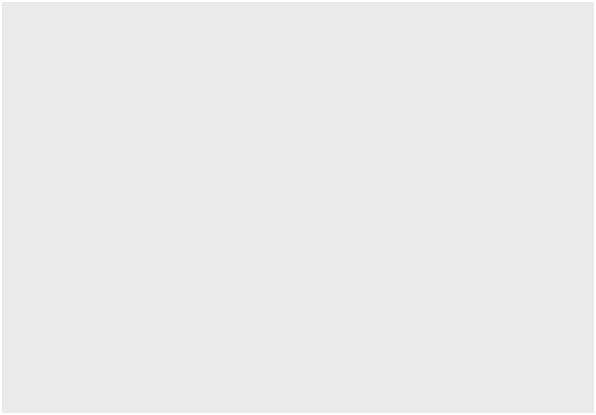
Derartige Informationen wenden
sich gleichermaßen an einen breiten Interessentenkreis als auch an das
wissenschaftliche Umfeld in der Region der herausgestellten Forscher. So
erfahren viele, wer die Koryphäen ihrer Region sind. Dafür interessieren sich
der potenzielle Patient, der Student, der eine hervorragende Ausbildung sucht,
der Wissenschaftspolitiker, der nur exzellente Wissenschaftlern und Projekte
fördern will und der anspruchsvolle Fachkollege, der qualitativ hochstehende
und effiziente Kooperationen sucht.
Fachbezogene regionale
Zeitschriften tragen Informationen aus den Bestenlisten in ihre Zielgruppen,
wie sich am Beispiel der folgenden Mitteilung zeigt, die auch im Internet zu
finden ist.
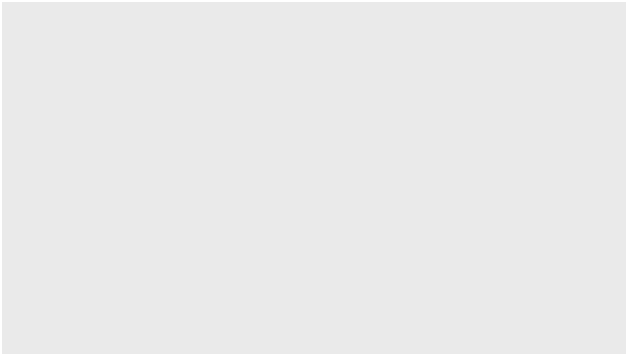
Zur Verbreitung trägt auch bei, wenn
Einrichtungen mit hervorragenden Forschern Links hier her legen. Dies taten
beispielsweise die Universität Wien mit dem Link Wissenschafter-Ranking
die-besten-nennen (http://www.meduniwien.ac.at/index.php?id=169)
und die Kinderklinik des Zentrums für
Kinderheilkunde der Universität Halle-Wittenberg
(http://www1.medizin.uni-halle.de/paediatrie/links/links.html).
Dass die Maßnahmen der aufgezeigten Art die
Verbreitung der Bestenlisten fördern, zeigt sich in der Zunahme der Besuche der
Internetseiten: In etwa verdoppeln sie sich pro Halbjahr.
Literatur und Links
Journalistische Beiträge, wie sie oben als
Beispiele wiedergegeben sind, vermitteln neben der Hervorhebung der
Spitzenköpfe, die in die Bestenlisten aufgenommen sind, immer auch
Hintergrundwissen über die Methodik und weitere Erkenntnisse im Umfeld der Identifizierung
dieser Besten.
Wer sich weitergehend informieren will, findet
auf diesen Internetseiten genügend Stoff. Er reicht von eher populär
geschriebenen Beiträgen bis zu streng wissenschaftlich verfassten Artikeln.
Diese enthalten jeweils Hinweise auf Belegliteratur und weiterführende
Literatur sowie Internet-Links.
Der schnellen Informierung dient der Beitrag:
Häufige Fragen und Antworten
(im
oberen Frame).
Einen
Überblick über vertiefende Themen gibt das
Inhaltsverzeichnis (im linken Frame).
Auf verschiedene Themen führen direkt
Der Hintergrund und
Die Erkenntnisse und Methoden (jeweils im linken Frame).
Auch Sie können weiter helfen
Falls Sie es ebenso wie wir für wichtig halten,
dass die Erste Liga der international erfolgreichen Wissenschaftler die ihr
gebührende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen gewinnt, um
ihre Leistungen weitgehend in die gesellschaftlichen Weiterentwicklungen
einzubringen und dabei u.a. an den wissenschaftlichen Nachwuchs weiterzugeben,
dann sprechen und schreiben Sie darüber mit anderen und verweisen Sie auf die
Bestenlisten.
Letzte Bearbeitung: 23.08.2004
Victor Apprendi